VÖA – „Verständigungsorientierte Öffentlichkeitsarbeit“ – das war der ‚heiße Scheiß‘ in der PR-Seminaren an der Uni Anfang der 1990er Jahre. Tatsächlich stand die These eines Paradigmenwechsels im Raum: Öffentlichkeitsarbeiterinnen und Öffentlichkeitsarbeiter liefern nicht mehr nur mundgerechte Info-Happen an die Journalistinnen und Journalisten, sondern moderieren gesellschaftliche Prozesse – ohne darüber nachzudenken, warum uns jemand dafür bezahlen sollte.
An eine grundlegende Studie zu diesem Thema konnte ich mich noch erinnern: „Public Relations als Konfliktmanagement“ von Roland Burkart von 1993. Das Modell einer verständigungsorientierten Öffentlichkeitsarbeit wurde am Beispiel der partizipatorischen Planungsprozesse zweier Sondermülldeponien in Niederösterreich untersucht. Spoiler: Hat nicht funktioniert, eine Verständigung kam nicht zu Stande.
Trotzdem finde ich es hin und wieder spannend, Ideen von früher nachzuspüren und im Abstand von 30 Jahren das Buch mit der heutigen Perspektive noch einmal zu lesen. Zum Ersten: Für eine wissenschaftliche Abhandlung ist das Werk angenehm kurz (166 Seiten) und recht verständlich geschrieben. Zum Zweiten weist das Forschungsdesign eine gewisse Eleganz auf: Es versucht, tatsächlich vorbildlich umfassend zu sein und nimmt den ganzen Kommunikationsprozess über Input, Throughput und Output ins Visier – also mit Inhaltsanalysen der Kommunikate, den Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger und dem Ergebnis der Kommunikationsbemühungen des Absenders. Viele andere Studien sind dagegen nur monomethodische Stichpunktmessungen, bei denen Ursachen und Wirkungen eher nur geraten werden können.
Das Modell der „Verständigungsorientieren Öffentlichkeitsarbeit“ geht – verkürzt zusammengefasst – davon aus, dass durch eine ausgehandelte gemeinsame Sicht auf die Sachebene bei gegebener Glaubwürdigkeit des Absenders und der Anerkennung der Legitimität des Handlungswunsches ein Einverständnis erzielt werden kann. Das kann gelingen, wenn die Öffentlichkeitsarbeit es schafft, die Sachverhalten verständlich zu erklären, den Absender als glaubwürdig darzustellen und den nachvollziehbaren Anspruch seiner Wünsche zu vermitteln.
Die Studie aus Niederösterreich kommt zu dem Schluss, dass sie zumindest habe aufzeigen können, was von dem idealtypischen Modell im Falle der Sondermülldeponien nicht funktioniert habe. Die Menschen wollen sich gar nicht so richtig partizipatorisch beteiligen und sie können sich eh nichts merken, was man ihnen in Flugblättern und Medienberichterstattung hat vermitteln wollen. Es bleibt eher etwas von den Infoveranstaltungen vor Ort hängen – und vor allem bei einzelnen, persönlichen Gesprächen: „Stellt man die Zusammenhänge zwischen Wissenstand und genutzten interpersonalen Kontaktmöglichkeiten einerseits sowie zwischen Wissensstand und Medienkontakten anderseits gegenüber, dann zeigt sich deutlich: der Einfluß der Massenmedien auf den Wissensstand ist weit weniger bedeutsam […].“ (S. 107) Das heißt Pressemitteilungen und bunte Broschüren helfen wenig: Man muss reden!
Der Begriff „Mediation“ war Anfang der 1990er noch nicht ganz so populär, aber wir Studierende sahen die Öffentlichkeitsarbeit der Zukunft eher als eine Art Moderations-Tätigkeit an und fragten uns, ob uns die Lehrpläne der Universität überhaupt das richtige Handwerkszeug vermittelten. Wir betrachteten PR weniger als Auftragskommunikation, denn als „Ausgleichskommunikation“. Die Tätigkeit einer PR-Abteilung lag weniger darin, das „Sprachrohr der Geschäftsführung“ zu sein, sondern darin den Rückkanal für die Bedürfnisse der Zielgruppen zu öffnen. Die „gute Öffentlichkeitsarbeit“ würde künftig eher wie „ausgleichende Gefäße“ funktionieren anstatt wie mit einem Feuerwehrschlauch in die Menge zu schießen.
Ich arbeite seit über 30 Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit, ausgleichende Prozesse habe ich dabei weniger moderiert. Eigentlich sendet sie weiterhin die Unternehmensbotschaften aus – vielleicht ist die Verständigungsorientierung dabei internalisiert wurden: Indem man die Bedürfnisse seiner Zielgruppen bei der Kommunikationsplanung versucht zu berücksichtigen, damit die Botschaften auch verstanden und auf fruchtbaren Boden fallen können. So gesehen war „VÖA“ auch eher nur eine Kommunikations-Utopie.
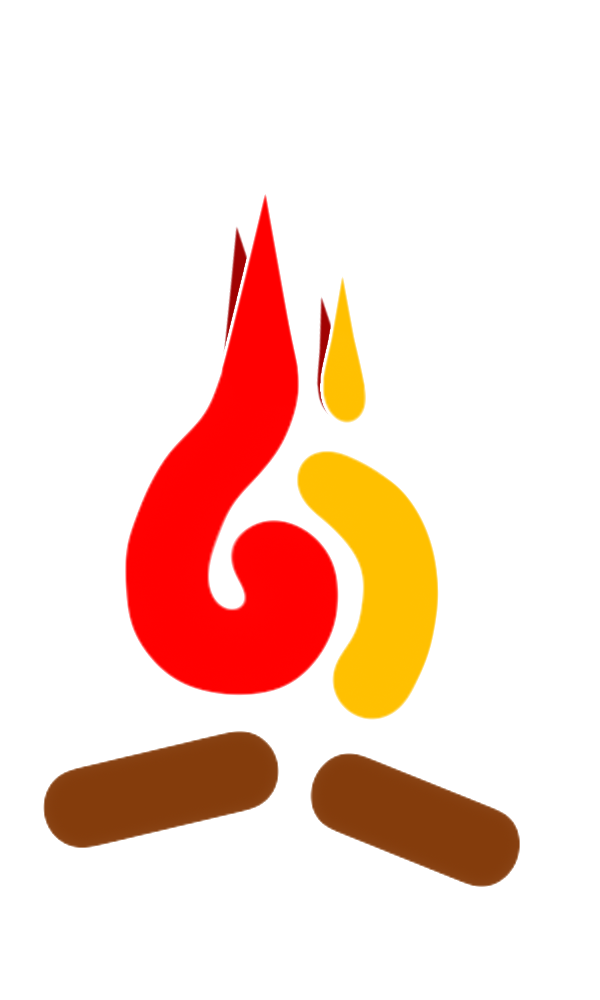

Schreibe einen Kommentar