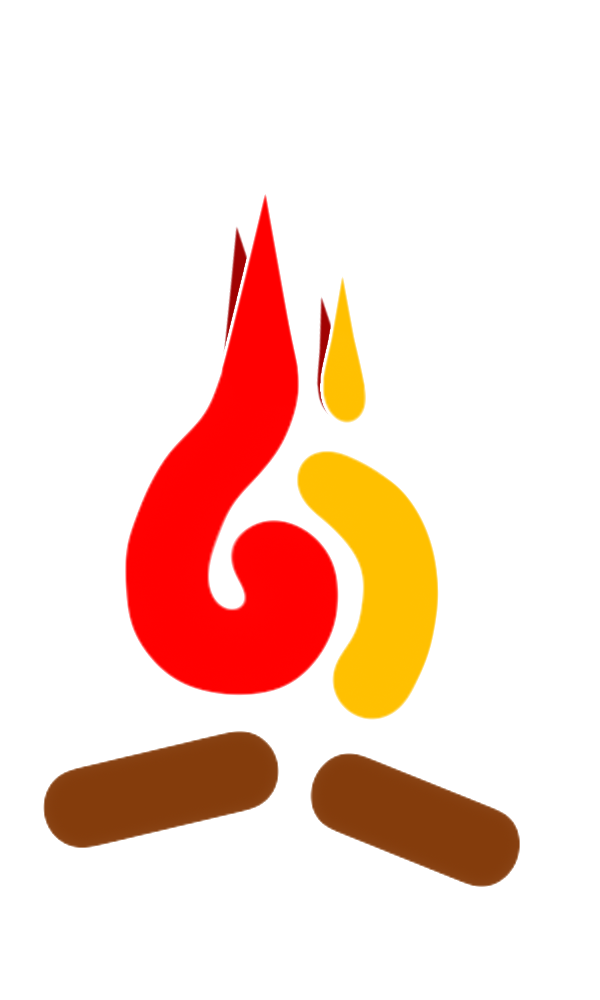- Präsentiert von
- WordPress
-
Museum mit Durchblick
In einer Zeit, in der alle zuhause bleiben sollen, sind Ausflugstipps besonders blöd – aber sagen wir mal so: Man kann sich darauf freuen, wenn man wieder raus darf… Viele hätten sich das Jahr 2020 sicher anders vorgestellt. So auch die Stadt Remscheid, die am 27. März 2020 den 175. Geburtstag von Wilhelm Conrad Röntgen, der…
-
Brettspiel mit Leitmotiv „Bauen“
Bauen ist kein (Kinder-) Spiel – wer selbst gebaut oder umgebaut hat kann ein Lied davon singen: Anträge, Genehmigungen, Gewerke, Handwerker und Bauaufsicht. In der Regel ist nichts davon so unterhaltsam, dass man sich ein Brettspiel darüber wünscht. Darüber hinaus mag es auch richtig sein, dass sich ⏩ betriebliche Zusammenhänge mit Brettspielen spielerisch erarbeiten lassen,…
-
Bauspiele
Es mag mit meinem Beruf zusammenhängen, dass ich mich aktuell für Bauspiele interessiere. Das Thema ‚Corporate Games‘ ist ohnehin eines meiner Steckenpferde. In einer Kreativ-Runde in einem Workshop zu den Themen Außenkommunikation und Werbemittel warf ich leichtfertig den Satz „Machen wir doch ein Spiel!“ in die Runde – schließlich ist beim Brainstorming ja jede Idee…
-
Multimediales Buch: Da ist Musike drin
[Werbung ohne Auftrag – ich hätte es ansonsten auch „Buchbesprechung“ nennen können] Ende 2019 erschien das Buch ⏩ „Ein Jahr voller Wunder“ von Clemency Burton-Hill, das bereits zwei Jahre zuvor auf Englisch erschienen war. Die Musikredakteurin einer BBC-Sendereihe und eines New Yorkers Klassik-Radiosenders empfiehlt darin für jeden Tag ein ausgewähltes Stück klassischer Musik – meistens…
-
Die irrationale Angst vor dem Stuhlgang
Stell Dir vor, Du sitzt auf dem Klo und es ist kein Papier da! Schlimmer geht’s scheinbar nimmer: Das wird in Witzen und Geschichten zur Genüge auswalzt. Und angesichts der derzeitigen Corona-Pandemie scheint die größte Sorge der Bevölkerung nicht die Ansteckung, die Todes-Rate oder der drohende wirtschaftliche Kollaps zu sein, sondern die Frage, wie man…
-
2. Wie viel Wohnraum brauche ich?
Wohnungswechsel ist immer lästig. Wir bleiben in der Regel dort wohnen, wo wir gerade sind, weil es bequemer ist als umzuziehen. Es gibt immer wieder im Leben Einschnitte und Veränderungen, die es erlauben oder nötig machen, über die Wohnsituation nachzudenken. Bei mir war es eine Trennung mit anschließender Scheidung. Nachdem ich mich einigermaßen wieder zusammengerauft…
-
1. Wohnen wird öffentlich
„My home is my castle“, sagt der Brite – gemeint sind dicke Mauern, die das Private von dem Öffentlichen als geschützter Rückzugsort abschirmen. Dieser findet auch im bundesdeutschen Grundgesetz als „Unverletzlichkeit der Wohnung“ (Art. 13 GG) seinen besonderen Schutz. Jeder kann nach seiner Facon hausen, wie er selig damit wird. „Zuhause“ war immer die private…
-
Die Sache mit den Erinnerungen, der Katze und dem Äffchen
Meine Freundin erinnert mich gerne daran, dass Erinnerungen sich verselbständigen können. Sie werden mit Erzählungen, Berichten und der eigenen Phantasie gerne ergänzt und überschrieben. Nichts sei trüglicher als die eigene Erinnerung – und das nehme mit dem Alter zu. Da ich nun jenseits der 50 bin, ist das Verfallsdatum vieler Erinnerungen bereits abgelaufen. Das habe…