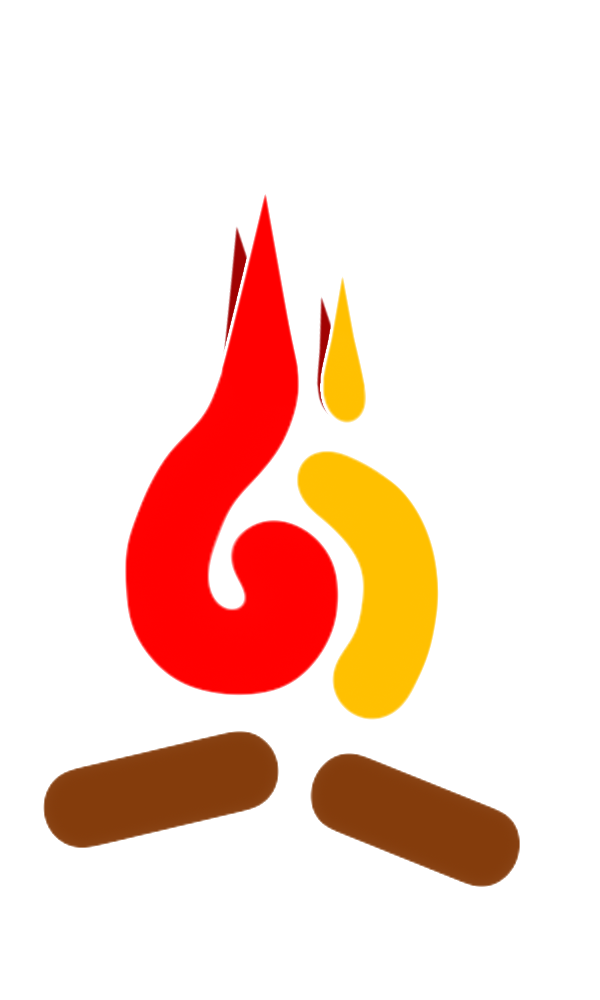- Präsentiert von
- WordPress
-
Vage Erinnerungen: Das Sopron-Project (Teil 1)
Erinnerungen sind mitunter trügerisch: Das, woran man glaubt, sich erinnern zu können, wird überlagert durch Gefühle, Empfindungen, Bewertungen und das, was andere darüber berichten – eingefärbt mit ihren Gefühlen, Empfindungen und Bewertungen. Kann man sich wirklich daran erinnern, wie der Polyacryl-Pulli immer so kratzte? War die Mauer hinter Omas Haus wirklich so hoch? Hatte man…
-
Geht immer: ein Bayer
In Bezug auf Romane kann man mit Thommie Bayer nicht viel falsch machen. Ich habe vor etlichen Jahren so einiges bis damals fast alles von ihm gelesen, dann länger Pause gemacht und nun über den jüngsten Jahreswechsel „Vier Arten, die Liebe zu vergessen“ weggelesen. Ich habe mich vom Titel locken lassen und fand auch, dass…
-
Begegnungen mit Beuys – Teil 2
Jetzt muss ich mich aber sputen, um noch vor Ablauf des „Beuys-Jahres 2021“ den zweiten Teil meiner Begegnungen mit Beuys zu liefern. Ging es im ⏩ ersten Teil eher um reale Begegnungen – mit dem Meister selbst 1992 auf der „documenta 7“ oder mit Tomasz Piwarski und Jenny Trautwein, die Sprößlinge aus den 7000 Beuys…
-
Was stimmt mit euch Nordrhein-Westfalen nicht?
OK, ich habe nichts zu sagen, weil ich Niedersachse bin. Ich bin in Goslar im Harz geboren, in Hannoversch-Münden aufgewachsen, habe meinen Wehrdienst in Buxtehude abgeleistet und meine ersten journalistischen Gehversuche bei der Gifhorner Aller-Zeitung gemacht. Alles war Niedersachsen – was keine besondere Leistung ist, denn Niedersachsen ist ein Flächenstaat und Gifhorn der größte Landkreis…
-
Begegnungen mit Beuys – Teil 1
Wir haben das Beuys-Jahr: 2021 wäre der Ausnahmekünstler mit dem Hut 100 Jahre alt geworden. Und zwar am 12. Mai. Das ist jetzt schon ein bisschen vorbei – aber das Jahr ist ja noch nicht ganz zu Ende. Ich hatte gar nicht vor, mich mit Beuys gedanklich auseinanderzusetzen, aber es gab in diesem Jahr ein…
-
#Zukunftscheck: Prognosen aus „Die Datenfresser“
Wir alle lieben es, wenn Menschen einen Blick in die Zukunft werfen. Und noch spannender wird es, wenn wir die Gelegenheit haben, diesen Prognosen zu überprüfen. Erinnert ihr euch noch an den 21. Oktober 2015? Das ist der Tag in der Zukunft, an dem Marty McFly im zweiten Teil von „Zurück in die Zukunft“ reist,…
-
Moralisch korrekt und außerhalb des Gesetzes
Ich lese wieder sehr viel in letzter Zeit – vieles ist unterhaltsam, anderes sehr lehrreich, aber so richtig beeindruckt hat mich ein Buch schon länger nicht mehr, so dass ich hätte darüber schreiben wollen. Aber diese Geschichte zeigte Wirkung: Es ist das von seiner Tochter aufgezeichnete Leben eines Mannes, der stets seinem moralischen Kompass folgte…