Die Pandemie hat mit uns allen etwas gemacht. Wir mussten unser Leben herunterfahren – Modus: Lebenserhaltung, Warten im Standby-Betrieb. Nicht alle Systeme lassen sich immer wieder problemlos hochfahren: Es besteht das Risiko, dass einige von uns in der Erstarrung dieser Stasis steckenbleiben könnten. Stell dir vor, die Pandemie wird abgesagt und du hängst noch im Corona-Betrieb fest.
Mit den drohenden Ende der Corona-Schutzmaßnahmen im März 2022, habe ich berechtigte Sorge in diesem Pandemie-Modus zu verharren. Ich stelle mir vor, der ehemalige Alltag kehrt zurück, Cafés und Restaurants füllen sich wieder, die Jugend macht Party und das Leben feiert Kirmes. Ich sitze stattdessen allein zuhause: isoliert, kontaktreduziert und FFP2-maskiert.
Ich habe mich in den vergangenen zwei Jahre so daran gewöhnt, nichts zu tun, dass ich mir nicht sicher bin, was ich denn dann eigentlich tun sollte, wenn man wieder tun darf. Auch vor der Pandemie hatte ich kein Sozialleben in festen Strukturen mit Fußball-Training jedem Mittwoch und Herrenchor am Samstag Abend. Ich ging gern zu losen Veranstaltungsreihen rund um Medien und Social Media, die es immer wieder in unregelmäßigen Abständen gab. Da trafen man „Kollegeninnen und Kollegen“ und Menschen, die nett sind und sich für ähnliche Dinge interessieren – aber eigentlich keine Freunde im engeren Sinne sind.
Meine Freunde wohnten überall in Deutschland verteilt, was sicher einer gewissen berufsbedingten Mobilität meinerseits geschuldet war. Dass es nicht so gut ist, die Freunde nicht direkt am Wohnort zu haben, merkt man erst, wenn man das Reisen und die Wochenendtrips wegen Reiseeinschränkungen und Kontaktreduktion einstellt. Umbrüche auf der privaten Seite führten dann dazu, dass ich eigentlich nur noch alleine zuhause hockte.
Es ist nicht so, dass ich mich gelangweilt hätte oder nicht wusste, was ich tun könnte. Ich habe mich eigentlich ganz gut beschäftigen können. In Ermangelung von Alternativen habe ich diese Aktivitäten gehegt, gepflegt, kultiviert und ausgebaut. Ich habe viel recherchiert, viel gelesen, ein Buch geschrieben. Aber alles ist eben nicht etwas, was man nach Beendigung der Pandemie einfach mit einem größeren Kreis als Gruppenaktivität gut fortsetzen könnte.
Der Krieg gegen das Virus geht zu Ende und nichts ändert sich für einen – so als hätte man das Kriegsende verpasst. So erging es ⏩ Yokoi Shōichi. Das „tapfere Schneiderlein“ war ein treuer Soldat und diente als Unteroffizier im 38. Infanterieregiment der 29. Mandschurei-Division. Als US-amerikanische Truppen 1944 die von Japan besetzte Insel Guam zurückeroberten, zog er sich mit ein paar Kameraden in den Dschungel zurück und verpasste die Kapitulation seines Heimatlandes. Erst acht Jahre später erfuhren sie durch Flugblätter, dass der Krieg vorbei sein. Aber Aufgeben wurde als unehrenhaft empfunden und so „kämpfte“ der Trupp weiter. 1964 starben die beiden letzten noch lebenden Gefährten, 1972 wurde der einsame Kämpfer von Fischern am Strand überwältigt, so dass sein ganz persönlich fortgesetzter Krieg erst knapp drei Jahrzehnte nach der letzten Schlacht seiner Einheit endete.
Ich habe berechtigte Sorge, dass es mir ähnlich ergehen könnte und mich das postpandemische Yokoi-Shōichi-Syndrom ereilt: Ich habe zwei Jahre alles getan, um einer Infektion zu entgehen – Maske getragen, Abstand gehalten, so gut wie niemanden getroffen und jede Impfung angenommen, die mir geboten wurde. Auch im empfinde es als irgendwie „unehrenhaft“ bei einer Inzidenz von vermutlich über 1000 zu kapitulieren. Ich werde weiterhin wie Yokoi-Shōichi in einem Erdloch sitzen und gefühlt dauerhaft im Ausnahmezustand bleiben, während das Leben zurückkehrt und weiterzieht und mich dabei zurücklässt.
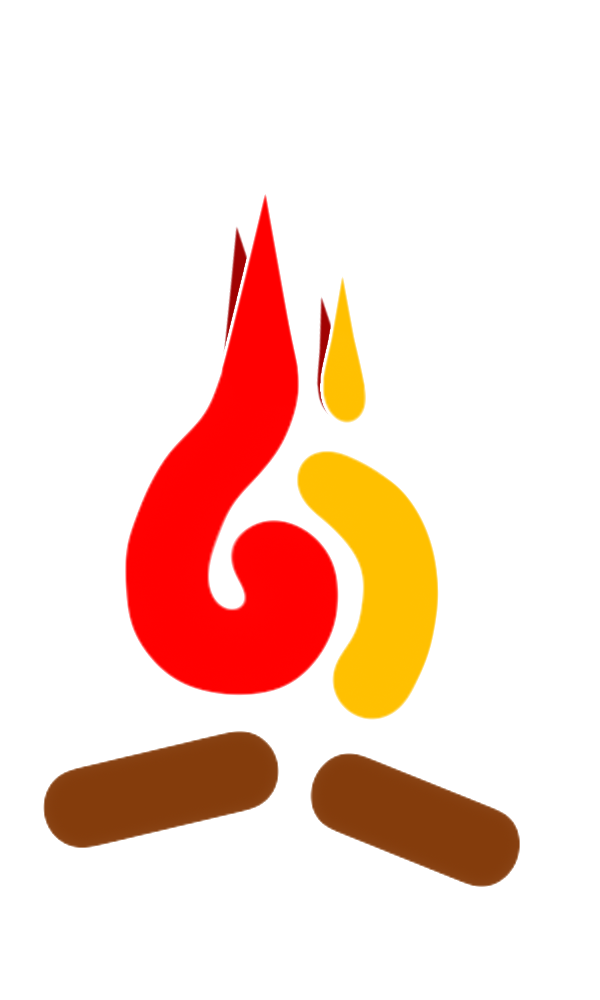

Schreibe einen Kommentar