Ich habe lange gezögert, ob ich überhaupt etwas zu diesem Thema schreiben sollte. Wenn jemand aus der alten Bundesrepublik etwas über die Einstellung der Menschen, die in dem Teil Deutschlands leben, der die ehemalige DDR war, ist das ein bisschen so, als würde ein Mann etwas zum Thema Menstruation beitragen wollen: Wer ist nicht selber erlebt hat, der möge gefälligst die Klappe halten!
Aber es nützt nichts: Wir müssen reden und wir müssen zuhören. Und wir müssen verstehen, warum es dem anderen vielleicht schwerfällt, die Dinge, über die wir reden, zu verstehen. Dann müssen wir noch mehr reden und noch mehr zuhören. Das hilft grundsätzlich bei jeder Form von Beziehung: Bei einem Paar, dass nach vielen Jahren Ehe das Gefühl hat, nur noch nebeneinanderher zu leben, aber auch bei Menschen, die von der westdeutschen Geschichte oder der ostdeutschen Geschichte geprägt wurden. Es ist nicht einmal notwendig, in der ehemaligen DDR geboren zu sein, auch Generationen von sogenannten „Nachwendekindern“ empfinden sich weiterhin beziehungsweise nun erst recht als „Ossis“. Und es waren die „Wessis“, die den Ostdeutschen zum „Ossi“ gemacht haben. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung auch eine Geschichte der Missverständnisse sowie der Stigmatisierungen.
Die Mauer ist weg, aber eine deutsche Einheit, die diesen Namen verdient hätte, hat es nie gegeben. Rechts und links des ehemaligen eisernen Vorhangs bleibt man zu verschieden. Und weil das lange Zeit nicht so gesehen wurde, nun erst recht!
„Die ostdeutsche Identität der Nachwendekinder sind insgesamt eine Reaktion auf drei Dinge“, schreibt ⏩ Valerie Schönian in ihren Buch ⏩ „Ostbewsusstsein“ auf Seite 94 und zitiert dann den Sozialwissenschaftler Daniel Kubiak: „Die Sozialisationserfahrung mit ostdeutschen Eltern, der pauschalisierende Schulunterricht und das Gefühl der Fremdzuschreibung als Ostdeutsche.“ Man wird nicht als „Ossi“ geboren, sondern zum „Ossi“ gemacht: Durch die Eltern, die ostdeutsche Sozialisation und die Medien.
Das ist alles an sich logisch und nachvollziehbar: Wenn sich ein politisches Gesellschaftssystem auflöst, bleiben die Menschen, die darin aufgewachsen geprägt von den Werten, die das bisherige System vermittelt hat. Davon werden sie einiges – vermutlich größtenteils unbewusst und als Sub- oder Kontext – auch an nachfolgende Generationen weitergeben. Das gelte auch für jegliche Traumata: „Unsere Untersuchungen und die anderer haben ergeben, dass durch die Fähigkeit des Menschen zur Resonanz traumatische und andere belastende Erfahrungen von Eltern an die nächste und übernächste Generation weitergegeben werden können.“ Das schreibt ⏩ Udo Baer in seinem Buch ⏩ „DDR-Erbe in der Seele“ auf Seite 178. Diese Weitergabe erfolgt nicht verbal, sondern auf der emotionalen Ebene. Natürlich muss man hier vorsichtig sein, denn Baer ist als Kind mit seinen Eltern aus der DDR geflohen und gilt eigentlich so als „Westdeutscher“. Die nonverbale Weitergabe von Traumata gab es natürlich auch schon vor der DDR: Wer im Dritten Reich sozialisiert wurde, konnte nach dem Krieg nicht aus seiner Haut – aber solche Zusammenhänge wurden eher totgeschwiegen, denn die junge Republik hatte andere Sorgen.
Das Schweigen der Eltern- und Großelterngeneration ist grundsätzlich problematisch, denn es verhindert an ihren Erfahrungen lernen und durch Verständnis die eigene Situation reflektieren zu können. Insoweit ist es zu begrüßen, dass eine jüngerer Generation in Ostdeutschland Geborener diesen Dialog sucht und einfordert – so wie es ⏩ Johannes Nichelmann tut und seine eigenen Erfahrungen eindrucksvoll und ausführlich in seinem Buch ⏩ „Nachwendekinder. Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen“ festhält.
Ganz mein Reden: Wir müssen reden!
Was bei Schönian (vgl. u.a. S. 91) und Nichelmann (vgl. u.a. S. 56ff) grundsätzlich mitschwingt: Erst die Konfrontation mit Westdeutschen habe aus den Ostdeutschen „Ossis“ gemacht. Ursprünglich hätten sich viele nur als „Deutsche“ gesehen, aber das westdeutsche Empfinden der Osten sei etwas Fremdartiges, habe eigentlich erst zur Ausprägung einer Ostidentität geführt. Ob Reisewarnungen in den Westen geholfen hätten? Man weiß es nicht. Aber wenn man das so liest, könnte man meinen, dass die Ostdeutschen die Opfer sind. Bewerten möchte ich das an dieser Stelle nicht (auch an keiner anderen).
Diese Abgrenzung zeige sich auch in der Wahrnehmung, dass ein Problem in Ostdeutschland ein ostdeutsche Problem sei, wohin gegen ein Problem in Westdeutschland ein gesamtdeutsches sei: „Eine Reaktion auf dieses Phänomen ist eine Identitätsbildung der separierten Gruppe.“ (Nichelmann, S. 59) Die Ausgrenzung der einen stiftet die Identität der anderen.
„Ostdeutschland muss als Sozialisationsraum etabliert werden“, fordert eine Gesprächspartnerinnen von Valerie Schönian (S. 59) und die Autorin ergänzt später, dass vorherige Generationen „ihr Ostdeutsch-Sein am liebsten ablegen. Ich will es mir erobern.“ (S. 74) Das mag auch einfacher möglicher sein: „Wo noch nicht alles da ist, kann mehr Neues entstehen. Wo Platz ist, lässt sich besser atmen.“ (S. 84) Das ist natürlich alles legitim und machbar. Deutschland ist ein bunter Flickenteppich regionaler Identitäten und jeder findet noch jemanden, von dem er sich abgrenzen kann: Die Kölner von den Düsseldorfern, die Duderstädter von den Eichsfeldern, die Franken von den Bayern.
Ich habe nichts dagegen, dass jemand seine „Ost-Identität“ auslebt, so wie manche Bayern, die gerne ihre „Mia san mia“-Mentalität in Lederhosen und Seppelhut ausleben – finde ich zwar lächerlich (also Lederhosen und Seppelhut), aber ich bin auch tolerant, so lange jeder seinen eigenen Stiefel durchzieht und niemanden dafür schlecht macht (so wie ich gerade ein bisschen). Interessant ist, dass es aber im Gebiet der ehemaligen DDR weniger um Spreewald versus Erzgebirge geht, sondern um ostdeutsch gegen westdeutsch.
Dahinter steckt das Meme vom Migrant im eigenen Land
Es taucht immer wieder das Motiv auf, dass den Ostdeutschen durch die Auflösung der DDR der Zugang zu ihrer Vergangenheit fehle: „Ich fühle mich wie ein Einwandererkind, wie der Sohn von jemanden der aus der Türkei hergekommen ist. Der kann, wenn er will, sich das Land seines Vaters anschauen. Ich kann es nicht.“ So zitiert Nichelmann eines der Nachwendekinder, mit denen er spricht (S. 87). Auch Maximilian geht es so: Er „fühlt sich wie das Kind von Einwanderern, das die Heimat seiner Eltern nicht mehr besuchen kann, denn sie ist schlichtweg nicht mehr existent“. (S. 126)
Es mag fadenscheinig klingen, aber den wenigsten von uns sind Zeitreisen möglich.
Ich weiß, dass ich gleich ausgebuht werden, aber mit der DDR ist eigentlich auch die alte BRD verschwunden. Das mag sich vielleicht für viele nicht so angefühlt haben, aber auch das Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin, ist verschwunden. Ich bin im Zonenrandgebiet aufgewachsen, was es in dieser Form nur geben konnte, weil es die DDR gab – inklusive „kleinem Grenzverkehr“ und „Zonenrandförderung“. Mit dem Untergang der DDR veränderte auch die Kleinstadt im ehemaligen Zonenrandgebiet ihr Gesicht: Mit der wegfallenden Förderung zogen auch etliche Industriebetriebe weg und die Bundeswehr-Einheiten wurden weiter östlich verlegt. Damit gingen Arbeitsplätze und somit auch Einwohner verloren – zwischenzeitlich fast 30 Prozent. Inzwischen positioniert sich das Städtchen als Seniorenparadies.
Meine Kinder können es nicht mehr sehen, wie es vorher war – dieses Fehl wird bei ihnen nun folgerichtig zur Ausbildung einer starken Südniedersachsen-Identität führen. Oder vielleicht auch nicht. Ist vielleicht auch besser so. Mein Vater ist 1956 aus Ungarn geflohen: Das Land gibt es noch und ich kann da noch hinfahren. Aber auch das heutige Ungarn hat so gut wie gar nichts mehr mit dem Ungarn zu tun, aus dem mein Vater geflohen ist. Genauso wenig, wie die heutige Türkei, dem Land ähnelt, aus dem die „Gastarbeiter“ in den 1970er Jahren nach Deutschland kamen. Ich glaube, da machen sich einige nur etwas vor und romantisieren etwas, das so verloren ist wie der heilige Gral.
Aber: Als Westdeutscher kann ich diesen Verlust natürlich nicht bewerten. Das steht mir nicht zu, denn im Westen hatten wir auch immer die bessere ökonomische Ausgangsposition, da – wie Valerie Schönian auf S. 86 schreibt – „wir ostdeutschen Nachwendekinder weniger Zahnarztpraxen erben werden als manch westdeutsche Altersgenossen“. Das stimmt: Ich habe sieben Zahnarztpraxen geerbt – und ihr so? Mal ganz ehrlich: Ich kenne nicht mal jemanden, der eine Zahnarztpraxis geerbt habt. Das macht mich nicht direkt zum „Ossi“, sondern wohl leider nur zu einem schlechten „Wessi“.
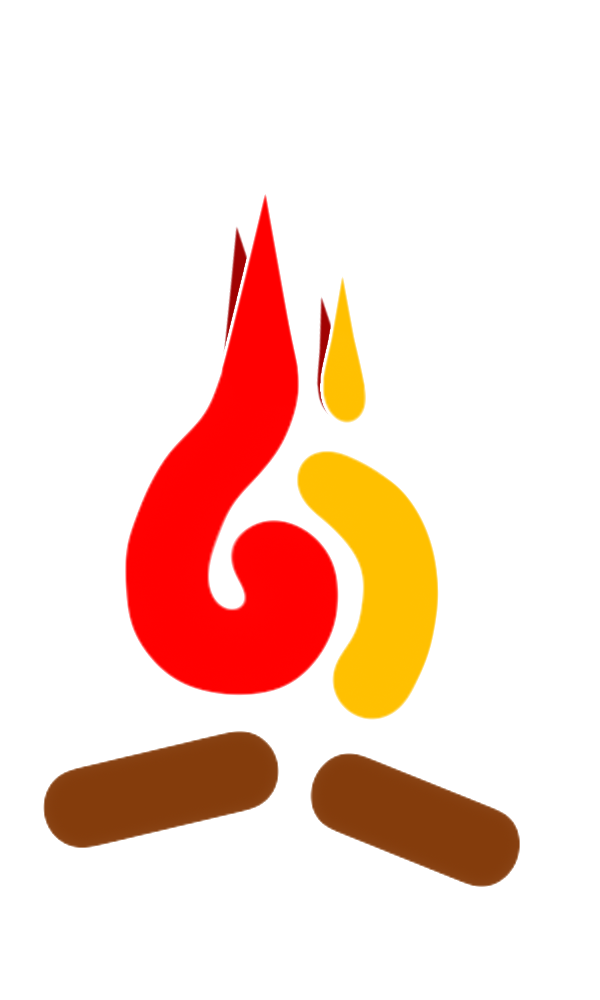

Schreibe einen Kommentar